Genug der Verwirrung
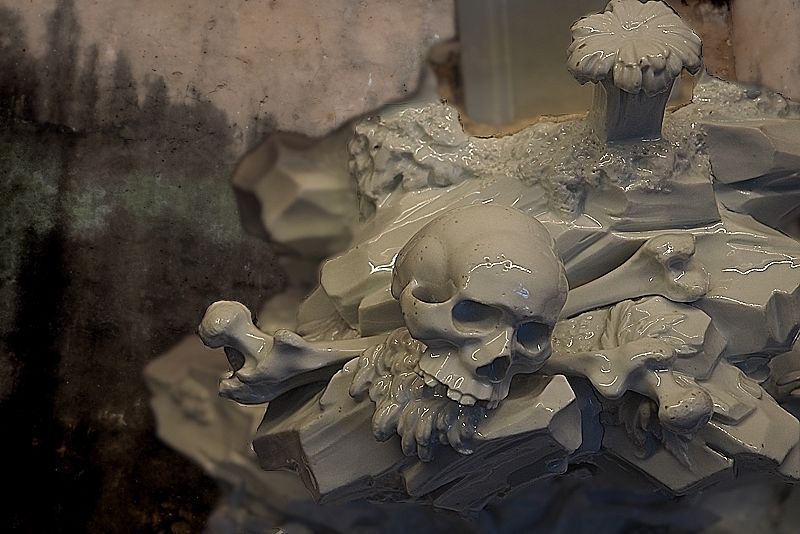
Kommentar zu einem Artikel in „Makroskop“ von Frank Furedi:
An dem Text von Furedi, wohlgemerkt aus dem Englischen übersetzt, und mit dem Umgang mit ihm, lässt sich wunderbar die Auflösung von „links und rechts“ deutlich aufzeigen.
Zunächst einmal: wer ist Frank Furedi? Der Soziologe Frank Furedi ist der Direktor des ungarischen Thinktank „MCC Brussels“, der für den ungarischen Präsidenten Orban, die ideologischen Grundlagen von Identitätspolitik, Kulturkampf und das technokratische Demokratieverständnis für dessen Einstellungen gegenüber der EU und dessen Auftritte im EU-Parlament vorbereitet. Er schafft die theoretischen Grundlagen für die Stellung des aktuellen Ungarns in der Europäischen Union.
Es ist schon sehr aufschlussreich, dass von so einem Thinktank-Mitarbeiter kritik- und kommentarlos in „Makroskop“ ein solcher, von einer derzeitigen Identitätsbesessenheit strotzender Artikel veröffentlicht wird. Es ist auch kein Zufall, dass Furedi auch andere Kanäle der sogenannten „alternativen Medien“ nutzt, wie z.B. „Tichys Einblick“, „achgut.com“, „novo-argumente.com“. Diese Hintergründe dürfen einem >wirklich kritischen< Leser nicht egal sein, wenn er sich über die Inhalte des Artikels Gedanken machen will. Neben der Frage, warum gleich „Krieg“ und nicht „Kampf“ oder „Auseinandersetzung“ oder „Disput“ oder oder, bleibt die Frage nach dem „Selbst“.
Diesem „Selbst“ wird ein „Gefühl der Beständigkeit“ zugeschrieben, das für den Blick „bewusst nach vorne und zurück“ Voraussetzung ist, um ein Erschaffen von „Dauerhaftem“ – wie z.B. „Tempel und Städte“ - und der „Sinnstiftung … stabiler sozialer und individueller Identitäten“ möglich sein zu lassen. In Zeiten, wie den unseren, die uns Menschen in „existentiellen Sinnkrisen“ versinken lassen, gedeiht die „Dezivilisation“. Es ist nicht nur das „Phänomen des (Aktuellen) Zeitgeistes“, sondern wärt schon seit der Moderne – seit „den letzten 150 Jahren“ (seit 1874 – seit der Romantik) – und „überlagert“ durch das „Bewusstseins des ständigen Wandels“ den „Sinn für Beständigkeit". Der „Trend an Dynamik“ verherrlicht die „Vergänglichkeit und Neuartigkeit“ zu Ungunsten des was Gestern war. Es herrscht das Motto: >das Neue ist das Neue<.
Gehen wir noch einmal auf den Begriff des „Selbst“ zurück, bevor wir uns den Begriffen Kultur und Zivilisation zuwenden. Das „Selbst“ ein Begriff aus der Philosophie und der Psychologie, wird in der Regel verstanden, als dass und wie sich ein „Mensch als ein einheitliches autonom denkendes und handelndes Wesen“ versteht. Es ist die Vorstellung unserer „Identität“, als einer von „Fähigkeiten und Schwächen, Erfahrungen, Wünschen und Ängsten“, die sich im Laufe eines Lebens herausbilden. Für eine Person, die in soziale und historische Dynamiken eingebunden ist, ist es unmöglich, sich nicht zu entwickeln. So „verändert“ sie „sich lebenslang immer weiter … je nach Kontext, Situation und Funktion“. Es werden „Gefühlsreaktionen … Rückmeldungen und Zuschreibungen“, eben „Bewertungen der eigenen Person durch Andere“ im besten Fall zu Kenntnis genommen und verinnerlicht.
So irrt sich Furedi, wenn er diese Form der immer wieder neuen Suche der Definition des >Wer bin ich< als „unaufhörliche Umwälzung“, als einen „regelrechten Fetisch“ und die „Malaise der Dezivilisation“ verurteilt. Auch irrt er sich, wenn der diese immer wieder neu zu stellende Frage nach dem „Selbst“ als Folge einer „Diskontinuität der Kultur“ deutet. Es ist nicht der „Verlust des Sinns für die Vergangenheit und damit ihrer moralischen Tiefe“, sondern die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit als eine kritikwürdige und zu überwindende. Auch wenn wir von unterschiedlichen nationalen Vergangenheiten ausgehen müssen, hat doch jedes Land seine eigene >schreckliche< Vergangenheit. An dieser Stelle kann und will dieser Artikel unserer speziellen deutschen Vergangenheit keinen Platz einräumen, aber so viel sollte klar sein, dass eine Auseinandersetzung in Zeiten wie der unseren unabdingbar ist. Es ist vielleicht der schlechten Übersetzung geschuldet, wenn nicht deutlich gemacht wird, dass für einen Engländer die Worte >Kultur> und >Zivilisation< etwas anderes bedeutet, als für einen Deutschen. Nur so viel: Laut Norbert Elias grenzt der deutsche Begriff „Kultur“ das deutsche Volk von anderen Völkern (z.B. den französischen) ab, weil dieser die nationalen Unterschiede – in der Kunst, der Literatur, der Musik, der Religion oder der Philosophie - , eben die Eigenart des deutschen Volkes – das Volk der Dichter und Denker – besonders hervorhebt. Es ist somit die national vorgestellte Kultur, die „uns“ Deutsche von den anderen zivilisierten Völkern hervorhebt. Furedi geht aber noch einen Schritt weiter und schafft, in der Beschreibung der „kulturellen Diskontinuität“, die „zur Negation ihrer vorherigen Prämissen führt“, den Sprung zur These der „“Akkulturation des Anti-Kulturellen““.
Ganz in seinem Sinne – >back to the future< - , zieht Furedi Lionell Trilling zu Rate. Zu Lionell Trillings kulturkritischen Schriften gehören The Opposing Self (1955), A Gathering of Fugitives (1956) und Beyond Culture (1965), die sich mit dem Problem gesellschaftlicher Identität in der Moderne befassen. Furedi benutzt Lionell Trilling, indem er ihn als Zeuge seiner Thesen aufruft, obwohl dieser einen gemäßigten Konservatismus vertrat, und keine >Retopia<-Ideologie. Im Gegenteil beobachtete Trilling das Aufkommen der neokonservativen Bewegung in den 70er Jahren mit Argwohn. Wie erst würde er die heute aufkommende „Neue Rechte“ beurteilen?
Laut Furedi positionierte sich Trilling 1961 gegen eine „affektgeladene Kulturkritik“, die er unter den Studenten der Revolte der sogenannten „68iger“ vorherrschend sah. Unter den „68iger“ wird Kultur „selten als ein System von Normen wahrgenommen, das dem menschlichen Leben Sinn verleiht.“ – Weil „Kultur … eher dem Ziel der Veränderung als der Erhaltung (dient) (…) (wird sie) herabgestuft, verflacht und ihres normativen Gehalts beraubt.“ So die Interpretation Trillings durch Furedi. Das Ganze dient dem Kampf gegen den „Geist der Gegenkultur“ der „68iger“-Generation, die mit dem Anti-Kulturellen erst die Akkulturation möglich machen. Was heißt das jetzt genau? Ersten wird „Gegenkultur“ und „Anti-Kultur“ gleichgesetzt und zweitens wird diese Gegenkultur als heute angeblich dominante und vorherrschende Kultur erklärt. Während damit die Menschen im Zustand der Unwissenheit, der Passivität und des Infantilismus belassen werden, wird der Akkulturation – der Übernahme einer fremden Kultur – Tür und Tor geöffnet. Dies ist die >vornehme Art und Weise<, wie man den Begriff der „Überfremdung“ umschreibt.
Einer seiner weiteren Kronzeugen seiner kruden rechtslastigen Identitätshysterie ist Daniel Bell. Er missbraucht Daniel Bell für seine reaktionäre Erkenntnis, dass der „status quo von einer „68iger“-Kulturelite pauschal als rückständiger Konservatismus oder als Unterdrückung“ verkannt wird. Mit der Behauptung, dass diejenigen, die die „kulturelle Diskontinuität“ als ein „ernsthaftes existentielles Problem“ ansehen, weil sie eine „Entfremdung von der Vergangenheit“ und damit eine „Entfremdung zwischen den Menschen in der Gegenwart“ fördert, von den „westlichen Eliten“ als „Nostalgiker“ abgetan werden, versucht er einen Gegensatz von „arroganten Eliten“ und einem „missachteten Volk“ aufzumachen. Es ist nicht nur die Missachtung der Andersdenkenden (dem konservativen Volk), sondern auch die „verächtliche Haltung gegenüber der Vergangenheit“ und der „Aufforderung mit dieser zu brechen“. Diese Aufforderung kommt, zu seinem großen Entsetzen auch noch ausgerechnet von denjenigen, die „die Verantwortung für die Bewahrung dieses Erbes tragen: (das kulturelle) Establishment“.
Die Folge dieses >Kulturkampfes< sind „Angriffe auf die soziale Struktur“(!), weil das Leben „in Gemeinschaften ohne Sinngeflecht“ als „Anomie“ und als pathologisch von Furedi beschrieben wird. Zu diesen Angriffen gehören, wie nicht anders zu erwarten, die Emanzipationsbewegungen wie der Feminismus. Flankiert werden diese „Angriffe“ durch die „westlichen Eliten“ (von wem denn sonst?), die diese „Angriffe“ als Fluidität, Flexibilität und Neuerfindung“ „positiv“ konnotieren. Es ist schon fast skandalös, wie hier Daniel Bell für Furedis xenophobe, misogyne, homophobe „Identitätsbesessenheit“ missbraucht wird. Daniel Bells drei Hauptthesen in seinen bekanntesten Veröffentlichungen nehmen Veränderungen in Politik, Sozialstruktur und Kultur zum Ausgangspunkt. The Cultural Contradictions olCapitalism (1976) thematisiert Entwicklungen in der US-amerikanischen Kultur. Es ist der sich ausweitende Massenkonsum, der zu einer hedonistischen und antinomischen Selbstbezüglichkeit führe, die in einem krassen Widerspruch zu den Erfordernissen des Erwerbslebens und des Wirtschaftssystems stehe. Infolge dieses Widerspruchs, so Bell, werde der Zusammenhalt der Kultur in Frage gestellt. Es sind also bei Bell keine rein kulturellen sondern wirtschaftliche Ursachen, die ihre Wirkungen in den individuellen Lebensentwürfen zu Verwerfungen führen.
So wie wir sowohl Teil einer globalen Klasse (übernational), als auch einer urbanen Kultur (übernational), sowie einer Milieukultur (Bildungsbürger), oder einer regionalen (eher West als Ost), bzw. einer lokalen (Berlin), als auch einer Hauptstadtkultur sein können, sind wir in unserer kulturellen Entwicklung auch durch Demos, Konflikte, Medien usw. beeinflusst worden. Damit ist es fast unmöglich, so homogen über Kultur zu reden, wie es einem FIDESZ nahen Ideologen aus Ungarn erfolgreich über die Lippen geht, weil das ganze Ländchen nur eine wirkliche Stadt hat – und das flache Land dort einem einheitlich revisionistisch, völkisch, religiös und gesellschaftspolitisch homogenen, katholisch-reaktionären Nationalismus folgt.
Zusammengefasst versucht Furedi mit seinem Artikel einen Angriff auf das was sich nach 1968 mit und durch die „68iger“ in der Gesellschaft positiver Weise realisiert hat: die offene, freie, heterogene und diverse Gesellschaft. Sie ist zum Glück nicht mehr homogen, einheitlich, identisch, konform und uniform. „68iger“ sei Dank!