Atomkraft - Pro, Contra und Konsequenzen
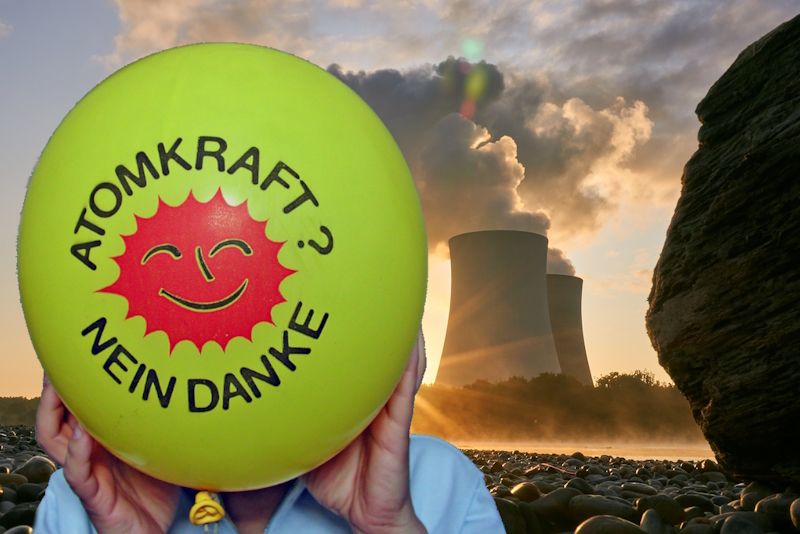
Kerntechnik - eine faszinierende Errungenschaft
Einsteins Gleichung E = m · c2 besagt, dass Masse und Energie ineinander umgewandelt werden können und welch immenses Potential darin liegt: c ist die Lichtgeschwindigkeit von ~300 000 km/s, so dass einer Masse m von nur einem Gramm eine Energie von ca. 25 Mio kWh zukommt. Dies entspricht z.B. 250 000 E-Mobil-Batterien von 100kWh Kapazität, von denen (Stand März 2023) jede über 500kg wöge [1].
Bei der Kernspaltung werden Atome eines chemischen Elements in “Bruchstücke” aus leichteren Elementen zerlegt. Dabei verbleibt ein kleines Massendefizit, das als Energie freigesetzt wird. Dass es gelungen ist, diese Umwandlung zu kontrollieren und für die friedliche Energieerzeugung nutzbar zu machen, war sicher eine herausragende gemeinsame Leistung von Physik (Erforschung der naturwissenschaftlichen Grundlagen), Ingenieurwissenschaften (Konstruktion zuverlässiger Technologien), Wirtschaft (Umsetzung in gewinnbringende Dienstleistungen – unter den gegebenen Rahmenbedingungen (s. unten)) und natürlich der Politik (Forschungs- und Wirtschaftsförderung, Setzung von gesellschaftlich – zumindest seinerzeit – akzeptablen Rahmenbedingungen)..
Pro: Atomare Energie als Brückentechnologie für die Energiewende
Da Atomkraftwerke (AKWs) im laufenden Betrieb keine Treibhausgase freisetzen, sind sie für die Eindämmung des Klimawandels von Interesse. Um das Jahr 2000 wurden hierzulande ca. 30% der elektrischen Energie atomar erzeugt [2, S.15]. Die Stromerzeugung mit Hilfe erneuerbarer Energien hatte 2023 einen Anteil von über 50% [2, S.12]. Wären die Kernkraftwerke von damals heute noch unter Nennlast am Netz, könnten demnach heute bereits ca. 80% des Stroms ohne Ausstoß von CO2 erzeugt werden. Berücksichtigt ist dabei, dass die Gesamtstromerzeugung seit dem Jahr 2000 leicht abgenommen hat [2, S.8].
Kernenergie, bei Produktion CO2-frei, hilft gegen Dunkelflaute
Während Kernkraftwerke bei der eigentlichen Stromerzeugung keine CO2-Belastung erzeugen, stimmt dies für deren Gesamtzyklus inklusive Bau, Rückbau, Brennstoffgewinnung und -erzeugung nicht. In [3], [5], [6] wird der Gesamtausstoß, umgelegt auf die erzeugte kWh, auf Werte zwischen 6 und 126 g/kWh geschätzt. Im günstigsten Fall ist die Kernkraft damit vergleichbar mit Wind- und Wasserkraft im ungünstigsten Fall immer noch 4-5 mal besser als ein Erdgaskraftwerk.
Atomkraftwerke können zudem helfen, das "Dunkelflautenproblem" [7] zu lösen: In windstillen Nächten oder Tagen mit dichter Bewölkung fallen Wind- und Solarenergiequellen praktisch aus. Für solche Situationen, aber auch für wetterbedingte Schwankungen im Normalbetrieb, braucht es Rückfallsysteme, die die Energielücken mit wenig CO2-Ausstoß schließen und deren Leistung relativ schnell regulierbar ist. Es gibt eine Reihe von Lösungsvorschlägen, die nur auf regenerativer Energiegewinnung beruhen (siehe z.B. [7]), aber auch die Atomenergie besitzt grundsätzlich die geforderten Eigenschaften [6], [8]. Allerdings sind Zeiten mit Teillastbetrieb oder gar Abschaltung von AKWs sehr teuer: Die Gesamtkosten eines AKW über seine Lebensdauer von ca. 60 Jahren bestehen zu 70% oder mehr aus den ursprünglichen Baukosten [3, “Wirtschaftlichkeit”]. Um daher insgesamt über die Lebensdauer hinweg – und unter den erwähnten Rahmenbedingungen – gewinnbringend zu sein, sollten Kernkraftwerke möglichst durchgehend und nahe ihrer Vollast betrieben werden [3, “Lastfolgebetrieb”]. Bei Berücksichtigung all dessen, könnte die Kernenergie dennoch einen kontinuierlichen Grundsockel an Energie liefern, der hilft das Dunkelflautenproblem zu mindern. “Mini-Atomkraftwerke” (engl.: small modular reactors (SMR)) [4], die mit dem Ziel entwickelt werden, die Atomkraft stärker zu kommerzialisieren, könnten – so dieser Weg beschritten werden soll – eine zentrale Rolle übernehmen.
Contra: Ökonomie, Endlagerung und mehr
Aus folgenden Gründen überzeugen mich die o.g. Argumente aber letztlich nicht:
Sicherheit, Versicherbarkeit und Ökonomie der Kernkraft
Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von Technologie einzugehen ist für die meisten Menschen akzeptabel, solange die Vorteile die zu erwartenden Schäden deutlich übersteigen. Wie schätzt man aber z.B. die “zu erwartenden Schäden” aufgrund der “größten anzunehmenden Unfälle (GAU)” von Kernreaktoren ein? Dazu sollten die zu erwartende Schadenshöhe und Häufigkeit eines GAU berücksichtigt werden. Die Häufigkeit in einer der in Deutschland zuletzt betriebenen Anlagen wird in Anmerkung [9, S.18] aufgrund theoretischer “probabilistischer Sicherheitsanalysen (PSA)” mit 1 bis 26,5 Ereignisse pro 5 Millionen Jahren angegeben. Damit wäre ein GAU zu unseren Lebzeiten extrem unwahrscheinlich. Nimmt man aber mit [10] die Daten aller AKWs der Erde und zählt die bekannten Fälle von Kernschmelzen (1xTschernobyl, 3xFukushima), kommt man auf etwa eine Kernschmelze binnen 10 bis 20 Jahren. Nun entsprach der Tschernobyl-Reaktor nicht den technologischen Standards, die in [9] zugrundegelegt wurden, und in Fukushima war die Auslegung des Gesamtanlage gegen Hochwasserereignisse offenbar nicht adäquat. Dennoch gibt es bei Abschätzungen der Wahrscheinlichkeit eines GAU zumindest beträchtliche Unsicherheiten. Denn niemand weiß z.B., mit welchen äußeren Einwirkungen, Fällen menschlichen Versagens oder mit bei den o.g. PSA übersehenen “common mode”-Fehlern[1] man es ggf. zu tun hätte? (Anmerkung der Redaktion: Ganz zu schweigen von den Gefahren, die von Reaktoren in Kriegsgebieten ausgehen, wie z.B. vom größten europäischen AKW Saporishnija, das bekanntlich russisch besetzt ist.)
[1] Ist das Eintreten zweier Ereignisse A und B getrennt betrachtet statistisch z.B. einmal in 1000 Jahren zu erwarten und ist das Eintreten von A unabhängig davon ob auch B auftritt und umgekehrt, dann ist das gemeinsame Eintreten von A und B einmal in 1000x1000 = 1 Mio Jahren zu erwarten. Gibt es aber z.B. ein bisher nicht berücksichtigtes Ereignis C, das einmal in, sagen wir, 100 Jahren zu erwarten ist und das sowohl A als auch B hervorruft, dann sind A und B gleichzeitig natürlich auch alle 100 Jahre zu erwarten. C ist dann eine gemeinsame Fehlerursache, ein sogenannter “common mode (of failure)”
Die aus einem Einzelereignis resultierenden Schäden sind zudem kaum vorhersagbar. Da sie außerdem u.a. den Verlust vieler Menschenleben und die radioaktive Verseuchung ganzer Landstriche oder von Millionen Tonnen von Kühlwasser [9] umfassen können, ist es oft irreführend zu versuchen, ihre Schadenshöhe in einer Geldwährung auszudrücken. Eine konkretes Beispiel dafür, welche Größenordnung von Kosten entstehen können, geben [12], [11]: Die Aufräumarbeiten rund um die Daiichi-Reaktoren in Fukushima wurden z.B., Stand 2019, auf 35 bis 80 Billionen[2] Yen, also ca. 210 bis 480 Mrd €, veranschlagt.
[2] 1 Trilliard im Englischen (Ref. [9]) entspricht 1 Billion im Deutschen.
Kernkraftwerke galten tatsächlich schon seit Beginn ihres Einsatzes in den 1950er Jahren als nicht versicherbar im Sinne der Versicherungswirtschaft. Bei der Setzung von rechtlichen Rahmenbedingungen verzichtete man deshalb auf eine auf wirtschaftlichen Prinzipien basierende Versicherung und ersetzte diese durch Staatsgarantien [13], [14]. Demnach haften Kernkraftwerksbetreiber individuell und als Kollektiv nur bis zu einer nicht sehr großen Schadenshöhe – in Deutschland sind das 2,5 Mrd Euro [14]. Darüberhinaus haftet zwar der Betreiber des fraglichen Kraftwerks allein, jedoch wird kaum ein Unternehmen für Schäden in der am Ende des letzten Abschnitts genannten Höhe aufkommen können. Somit wird also der Staat – nicht zuletzt mit Hilfe des Steueraufkommens – einspringen und letztlich eine Gratisversicherung bereitstellen müssen, wie in Japan geschehen [11]. Wird dies in Wirtschaftlichkeitsrechnungen nicht berücksichtigt, muss es m.E. als massive versteckte Subvention gelten. Externe Kosten der Atomstromerzeugung, für die ebenfalls letztlich die betroffenen Staaten geradestehen und die durch “Strahlen-Emissionen beim Uranbergbau, mögliche Strahlen-Emissionen beim Betrieb, den langwierigen und technisch anspruchsvollen Rückbau von Kraftwerken, die ungeklärte Frage der langfristigen Lagerung von Atomabfällen (s.o.) sowie das Risiko der Proliferation”[5] verursacht werden, sollten wohl ebenso berücksichtigt werden.
Man mag die Kernenergie für so wichtig halten, dass sich solche indirekten Subventionen rechtfertigen ließen. Heutzutage sollten dann aber auch die ökonomischen Karten auf den Tisch und offengelegt werden, dass Strom aus Kernenergie ökonomisch wohl kaum konkurrenzfähig ist. Eine Referenz für solche Berechnungen, die das CO2-Einsparpotential und die Kosten verschiedener Klimaschutzmaßnahmen zusammenbringt, enthält der 6. Bericht des “Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC)” [15], [16]. (Anmerkerung der Redaktion: Es gilt inzwischen als wissenschaftlicher Konsens, dass erneuerbare Energien in Aufbau, Betrieb und Rückbau günstiger sind als Kernenergie.)
Radioaktive Abfälle und Endlagerung
Die Eckdaten zum Thema Reaktorabfälle und Endlagerung in Deutschland sind öffentlich einsehbar [17]: Bis 2080 wird laut Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ca. 10 500 Tonnen hochradiaktiven Mülls aus abgebrannten Kernbrennstäben, bis 2060 mit 300 000 Kubikmetern anderen, schwach- und mittelradioaktiven Abfällen gerechnet. Diese müssen – je nach Zusammensetzung – für hunderte bis Millionen Jahre sicher gelagert werden. Nach neuestem Stand der Erkenntnisse rund um die Endlagerung und nach der entsprechenden Gesetzgebung könnte es bis zum Jahr 2074 dauern, bis ein Endlager in Deutschland gefunden ist [18, Abschn. 9.4, S. 254], [19]. Mindestens bis die Suche danach abgeschlossen ist, müssen die Abfälle weiter in über 1000 CASTOR-Behältern mit höherem Risiko an verschiedenen Orten zwischengelagert werden [19]. Konnte man zu Zeiten der frühen Begeisterung für die wissenschaftlich-technologische Bändigung der Kernspaltung vielleicht noch akzeptieren, dass nicht alle Probleme gleichzeitig lösbar waren und dass man sich der Frage der Endlagerung dann demnächst widmen werde, scheint dies aus heutiger Sicht, nach 60 Jahren der friedlichen Nutzung der Kernenergie, unakzeptabel. Die oben genannten Probleme sind noch genauso drängend, wie seinerzeit – Lösungen sind sicher nicht in greifbarer Nähe. Und es bleibt abzuwarten, ob sie wenigstens in absehbarer Zeit noch in Sichtweite kommen. (Anmerkung der Redaktion: Nach Angaben der Bundesgesellschaft für Endlagerung soll die Benennung eines Standorts für die Endlagerung in Deutschland bis 2046 und 2068 dauern [https://www.endlagersuche-infoplattform.de]).)
Weiteres: Abhängigkeiten, Klimawandel, SWR, Todesfälle, Generationengerechtigkeit
Auch mit der Kernenergie hängt man, wie mit den fossilen Energieträgern, von natürlichen Ressourcen ab. Es entstehen also, wie bei den fossilen Energieträgern, internationale Abhängigkeiten, da Deutschland seine Uranförderung im Nachgang der Wiedervereinigung eingestellt hat [20], [21].
Aufgrund der Notwendigkeit gleichmäßiger und zuverlässiger Kühlung - meist mit Flusswasser, sind große Kernkraftwerke abhängig von der weiteren Entwicklung des Klimawandels. So hat Frankreich im Jahr 2022 aufgrund der Trockenheit, die die Flusspegel im Land stark abfallen ließ, fünf seiner 56 Kernkraftwerke gedrosselt, um einer übermäßigen Aufheizung des Flusswassers durch die AKW-Abwärme entgegenzutreten [22]. Das mag nicht nach allzu großen Einschränkungen klingen, aber der Klimawandel ist auch noch nicht am Ende.
Eine Diskussion zur Sicherheit von Mini-Atomkraftwerken (SWR) und weitere Referenzen dazu finden sich in Anmerkung [4].
Es wird, etwa in den Anmerkungen [23] und [24], argumentiert, dass die Anzahl von zu beklagenden Todesfällen im Zusammenhang mit der Kernkraft deutlich kleiner sei, als dies für Todesfälle im Zusammenhang mit fossilen, aber auch erneuerbaren Energiequellen der Fall ist. Obwohl ich diese Aussage nicht bezweifle, greift dieses Argument m.E. deutlich zu kurz: Schwere Reaktorunfälle, wie diejenigen in Tschernobyl und Fukushima, gehören zum Typ (hoffentlich) sehr seltener und bezüglich ihrer Auswirkungen nur sehr schwer einschätzbarer Ereignisse. Es kann weder jemand sagen, wann oder ob das nächste Ereignis dieses Typs eintreten wird, noch ob wir dabei wiederum so relativ glimpflich davonkommen werden, wie dies bei Tschernobyl und Fukushima der Fall war.
Letztlich sei noch auf das Gebot der Gerechtigkeit zwischen den Generationen hingewiesen: Die Verlängerung der friedlichen Kernkraftnutzung mit der Begründung, damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ist m.E. zumindest halbherzig. Letztlich geht es um die größere Frage der Nachhaltigkeit, denn nur wenn diese hergestellt ist, können unsere Folgegenerationen auch auf lange Sicht mit einem auskömmlichen Leben rechnen. Wenn wir aber ein Nachhaltigkeitsproblem (Klimawandel) angehen, indem wir ein anderes massives Problem (ungelöstes Kernenergieabfallproblem) weiter verschärfen, dann ist das für die Folgegenerationen wohl kein attraktiver Weg. (Anmerkung der Redaktion: Allein die Halbwertszeit von Plutonium 239 als einem der Bestandteile des radioaktiven Abfalls beträgt mehr als 24 000 Jahre. Eine Belastung der künftigen Generationen über derartige Zeiträume kann wohl kaum nachhaltig genannt werden).
Fazit
Der Wiederaufbau einer AKW Infrastruktur in Deutschland ist nach den Weichenstellungen der letzten zehn Jahre wohl keine Option mehr: Er würde aus den o.g. Gründen zu teuer und erfahrungsgemäß zu langwierig, um für den Klimaschutz noch eine Rolle spielen zu können. Investitionen in unsere Energieversorgung sollten stattdessen der Entwicklung und dem Ausbau wirklich nachhaltiger und günstigerer Gesamtkonzepte für erneuerbare Energien zugute kommen. Wird dieser Weg verfolgt, plädiere ich dann allerdings für Technologieoffenheit und fairen wissenschaftlichen und ökonomischen Wettbewerb [25].